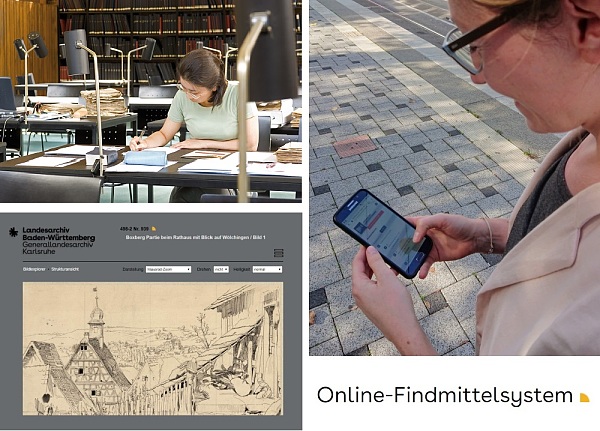Jeder hat das Recht, Archivgut zu nutzen. Bei Forschungsvorhaben zum 20. Jahrhundert sind jedoch die Schutzfristen des Landesarchivgesetzes (§ 8 LArchG) und die Schutzfristen des Bundesarchivgesetzes (§ 11 BArchG) zu beachten. Die Schutzfristen des Bundesarchivgesetzes sind anzuwenden auf Archivgut, das von nachgeordneten Stellen des Bundes dem Landesarchiv übergeben worden ist oder das Geheimhaltungsvorschriften des Bundesrechts unterliegt.
Archivgut darf in der Regel 30 Jahre nach dem Entstehen (nach dem Schließen der Akte) genutzt werden. Diese Schutzfristen können verkürzt werden, wenn schutzwürdige Belange von Betroffenen nicht entgegenstehen. Archivgut, das Rechtsvorschriften über Geheimhaltung unterlag, darf frühestens 60 Jahre nach dem Entstehen genutzt werden. Diese Schutzfristen können um 30 Jahre verkürzt werden.
Archivgut des Landes, das sich auf natürliche Personen bezieht, darf frühestens zehn Jahre nach deren Tod genutzt werden. Wenn deren Todestag nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand feststellbar ist, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt der Betroffenen. Diese Frist darf nur verkürzt werden,
- wenn die Betroffenen, oder im Falle ihres Todes, die Hinterbliebenen (Ehegatte, Kinder, Eltern) eingewilligt haben;
- wenn die Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken unerlässlich ist,
- wenn die Nutzung zur Wahrnehmung berechtigter Belange, die im überwiegenden Interesse einer anderen Person/Stelle liegen, unerlässlich ist.
Die schutzwürdigen Belange der Betroffenen müssen dann durch Anonymisierung oder durch andere Maßnahmen angemessen berücksichtigt werden.
Archivgut des Bundes, das sich auf natürliche Personen bezieht, darf erst 10 Jahre nach deren Tod genutzt werden. Wenn deren Todestag nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand feststellbar ist, endet die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt der Betroffenen. Diese Frist kann verkürzt werden,
- wenn die Einwilligung des Betroffenen vorliegt;
- wenn die Nutzung für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben unerlässlich ist,
- wenn die Nutzung zur Wahrnehmung berechtigter Belange, die im überwiegenden Interesse einer anderen Person/Stelle liegen, unerlässlich ist.
Eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange muss dann durch angemessene Maßnahmen, insbesondere durch Vorlage anonymisierter Reproduktionen, ausgeschlossen werden.
Die Schutzfristen von LArchG und BArchG gelten nicht für Archivgut, das schon bei seiner Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich war (§ 8 Abs. 3 LArchG, § 11 Abs. 5 BArchG). Für Amtsträgerinnen und Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter und Personen der Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen nur, sofern deren schutzwürdige Privatsphäre betroffen ist.
Für nichtstaatliches Archivgut können weitergehende gesetzliche Rechte und besondere Vereinbarungen gelten.
Die Nutzung gesperrten Archivguts setzt einen genehmigten Antrag auf Verkürzung von Schutzfristen (Formular) voraus. Schutzfristen werden grundsätzlich nur für einzelne Archivalieneinheiten verkürzt. Deren Erfassung mit Signatur, Aktentitel, Laufzeit und gegebenenfalls Lebensdaten erfolgt im Formular.
Für personenbezogenes Archivgut schreibt das LArchG die Einwilligungserklärung der Betroffenen oder ihrer Hinterbliebenen vor (siehe oben).
Anträge mit Anlage und gegebenenfalls Einwilligungserklärung werden jeweils bei der Abteilung des Landesarchivs gestellt, die das Archivgut verwahrt, dessen Schutzfristen verkürzt werden sollen. Die Abteilung prüft den Antrag und teilt ihre Entscheidung schriftlich mit.
Die Verkürzungsgenehmigung gilt bis zum Abschluss des Nutzungsvorhabens. Die Pflicht zur Beachtung schutzwürdiger Belange von betroffenen Personen bleibt darüber hinaus bestehen.